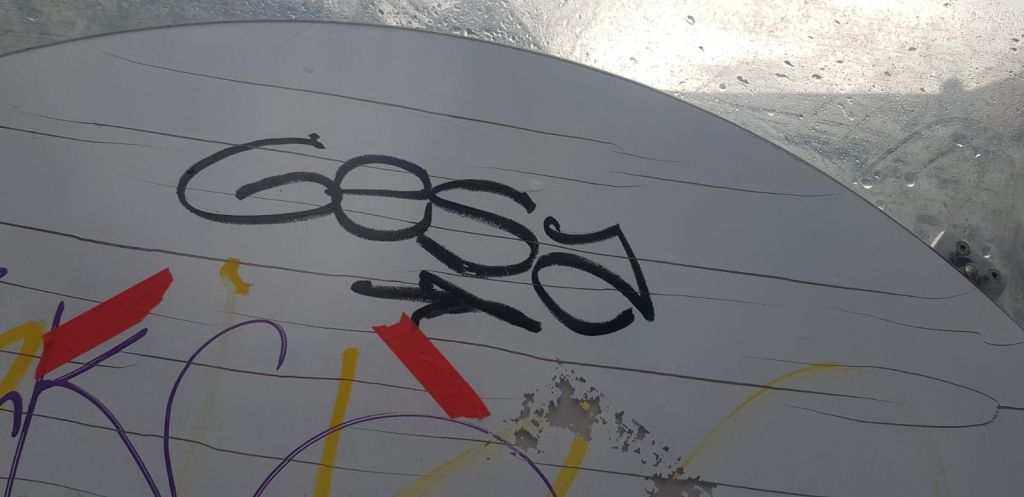
Ich lese gerade ein Buch, dass mir jemand empfohlen hat. Ich werde sie hier die Füchsin nennen. Das Buch ist von Irvin D. Yalom und heißt: Liebe, Hoffnung, Psychotherapie. Es inspiriert mich zu folgendem Text:
In meiner Kindheit schaue ich mir von den mich umgebenden Menschen ab, dass es wichtig ist im Moment zu funktionieren. Dass konstant daran gearbeitet wird, ganz viel zu arbeiten, abzuarbeiten, die Menge an Arbeit nie abnimmt aber zumindest der Eindruck ständiger Beschäftigung mit eben dieser Arbeit hilft, ein Gefühl von Übersicht, Kontrolle zu erarbeiten.
Dauerhafte Kontrolle gibt es nicht. Der beschäftige Versuch nach Kontrolle nimmt Raum ein. Nimmt Platz wo eigentlich Unlust, Wut, Genervtheit, Trauer, keine Zeit zum Spielen zu haben, sind. Diese Gefühle reiben auf, sie zu fühlen bringt nichts voran, als wende ich mich von ihnen ab indem ich eine Mauer um sie baue. Eine Mauer gegen das Fühlen. Ich sperre meine Normalität durch die Mauern aus. Grenze alles ab, was ich nicht kenne. Und passe alles so an, dass ich Teil der Normalität, meiner Umgebung sein kann. Jetzt herrscht Ruhe.
Nur manchmal, dann immer öfter, höre ich, dass hinter der Mauer etwas ist, das versucht die Mauern zu durchbrechen. Wut, Trauer, Hoffnung, Liebe stehen davor und kämpfen um Aufmerksamkeit. Sie schlagen gegen die Mauern, sie rufen laut und deutlich: „Wir sind hier. Nimm uns wahr!!“ Der ständige Lärm vor meinen Mauern ermüdet mich, lässt mich nicht mehr schlafen, strengt mich an. Ich will das nicht. Also suche ich einen Weg, sie nicht mehr zu hören. Alles was ich tue ist darauf ausgerichtet, die Stimmen nicht mehr wahrzunehmen. Eines Tages wache ich auf mit dem Rücken zur Mauer und habe vergessen, was hinter mir ist.
In meiner Jugend arbeite ich genauso, wie ich es als Kind beobachtet habe. Ich mache alles, was von Außen an mich herangetragen wird. Hinterfrage nichts. Sage nicht nein. Jeder Tipp, jede Anmerkung, die irgendwo herumliegt, mache ich zu meiner Aufgabe.
Habe ich Ruhe, bin ich nervös. Ruhe heißt, ich kann gerade nicht funktionieren. Ich kann gerade keine Arbeit ableisten, mich bewähren, beweisen, dass ich Teil der Normalität bin. Also provoziere ich Stress. Der eine Zustand, der mich absurderweise beruhigt. Ich streite, ich bin angespannt, niemand traut sich an mich ran.
Ich mache viel zu viel Uni, Sport, Auslandsjahre, betreue Freundinnen durch herausfordernde familiäre Situationen, halte das Taschentuch, sobald eine Bekannte Liebeskummer hat, und lade mir noch den Uni-Kurs auf Englisch auf. Ich bin komplett überfordert, aber so ist das Leben: anstrengend.
Ich breche körperlich zusammen, bekomme Panik Attacken, streite mit Menschen, um irgendwie dieses viele, zu viele, aus mir raus zubekommen. Kann nicht mehr alles essen, nicht mehr gut schlafen, kraze mir das Gesicht blutig. Mir ist ständig schlecht, ich habe Bauchweh, Durchfall.
Was ist nur los mit meinem Körper? Ich fühle mich ungenügend, der Normalität nicht gewachsen. Mein Körper funktioniert nicht so, wie ein normaler Körper funktioniert. Ich bin verzweifelt, orientierungslos, weiß nicht was ich tun kann, um meinen Körper zu helfen. Bin übermüdet.
Als junge Erwachsene bin ich misstrauisch, und manchmal verstörend traurig ob der Zurückweisung. Ich versuche euch alles Recht zu machen! MERKT IHR DAS NICHT?. Wieso sind die so, die anderen? Was habe ich denen getan? Warum schließen die mich aus? Mir fehlt ein innerer Kompass, an dem ich erkenne, was richtig oder falsch ist, wohin ich gehen will und was ich lieber auslasse. Ich kreise um mich selbst, bis mir schwindelig ist. Ich will aussteigen.
Stattdessen versuche ich weiterhin allen ihre Bedürfnisse zu erfüllen, Orientierung in ihnen zu finden. Fremdgesteuert hangle ich mich durch mein Leben, von einem Ast hin – und zurück. Hin und zurück. Ich bin zu schwer, ich hänge und hänge, immer am den gleichen zwei Ästen. Ich lasse mich fallen, lande in meinem Bett und werde nicht aufstehen.
Ich denke, ich will meinen eigenen Baum. Dann kann ich das damit Holz ernten und aus den Brettern einen, meinem Pfad zimmern. Ich wässere die Setzlinge mit meinen Tränen, demn so ergibt meine Verzweiflung Sinn. Die Setzlinge wachsen und ein kleiner Wald entsteht. Wo ein Wald, dort sind auch Tiere und eines Tages schreitet die Füchsin in mein Leben.
Sie sagt: „Schau dich um, siehst du, du stehst vor einer Mauer. Du schleichst vor der Mauer hin und her und weinst vor dich hin.“ Ich stütze mich auf dem Bett auf und fühle mich ertappt. Ich drehe mich um, und sehe die Mauer. Ich kenne die Mauer. Steht vor mir und trotzdem fühle ich mich von ihrer Gewalt erdrückt.
Ich wende mich der Füchsin zu, und ich denke, dass alles leichter wäre, wäre ich auch ein Fuchs. Ich versuche ein Fuchs zu werden. Da spricht die Füchsin wieder, dieses mal etwas lauter:“ Du kommst auf deinem Weg nicht voran, wenn du die ganze Zeit auf eine Mauer starrst und gleichzeitig versuchst jemand anderes zu sein.“
„Wer bin ich?“, Frage ich die Füchsin! „Woher soll ich wissen, wo ich hin soll, wenn nicht entlang der Mauer?“ Ich will meine Füße dazu bewegen, mich umzudrehen. Aber ich habe Angst, dass wenn ich mich umdrehe, dass die Mauer dann auf mich fällt. Oder vielleicht sogar weg ist. Wo soll ich denn wissen, wo ich stehe, wenn da keine Mauer mehr ist?
Die Füchsin beobachtet mich, ignoriert meine Frage und sagt: “ Eine Mauer ist keine Landkarte, sie ist kein Kompass. Sie ist eine Mauer. Sie kann dir keine Orientierung geben. Wenn du eine Landkarte willst, dann musst du eine Landkarte zeichnen.“
Und weiter: “ Eine Mauer kann einsperren, eine Mauer kann versperren, eine Mauer kann eine Hürde sein. Sie kann aus Stein, sie kann aus Lehm sein. Sie kann überwindbar oder unüberwindbar sein. Sie kann stahlhart sein oder wie aus Gummi. Aber: Wenn du eine Landkarte zeichnen willst, musst du erkennen, dass da eine Mauer steht.“ Dann schweigt sie und Stille breitet sich aus.
Ich schaue mir die Mauer an, und suche nach Spuren in der Mauer. Spuren von der Person oder den Personen, die diese Mauer aufgebaut haben! Woher kommen die Steine für die Mauer? Aus welchem Material sind die Steine? Warum sind die Steine so, und nicht anders aufgeschichtet worden? Warum brauche es diese Mauer hier und nicht woanders? Gab es schon ähnliche Mauern?
Und ich suche nach Spuren von dem, was hinter der Mauer sein könnte! Dann akzeptiere ich die Stille und setze mich vor die Mauer und akzeptiere, dass die Mauer da ist. Ich akzeptiere, dass die Mauer da ist, und dass es mich stört, dass sie da ist. Und dann bemerke ich, wie die Mauer mich von dem trennt, was auf der anderen Seite ist. Und dass es diese andere Seiten geben muss.
Je länger ich die Mauer anschaue, je neugieriger ich werde, desto vertrauter wird mir die Mauer. Ich beginne jetzt mit der Mauer zu reden, ich sage ihr, dass sie mich einsperrt. Ich beklage, dass ich wegen ihr nicht weiß, wo ich bin. Ich sage ihr, dass ich wegen ihr nichts anderes erkennen kann, als die Grenzen, die sie mir setzt. Desto mehr ich spreche, desto stärker spüre ich, dass ich traurig bin, dass die Mauer da ist. Und dann passiert ist: Ich weine im hier und jetzt, genau hier, ich weine darüber, dass ich hier sitze und die Mauer da ist. Und hinter dieser Trauer, entdecke ich noch eine andere Trauer. Eine die so groß ist, dass sie mich überwältigt. Ich schließe die Augen und sehe all das, was ohne die Mauer hätte sein können. Es dauert ewig und doch hat es ein Ende.
Ich atme tief ein, spüre, dass ich mich freier fühle, blicke in mich hinein und sehe auch das, wovor mich die Mauer beschützt hat. In mir breitet sich dankbare Wärme. Ich öffne die Augen und die Mauer ist weg.
Vor mir steht ein Baum , mein Baum. Nein, vor mir steht ein ganzes Leben an Wald, grün und voller Lebenskraft. Ich kann den Frühling riechen, dessen Kraft den Wald zum Leben erweckt. Ich kann die Vögel hören, die sich über mich unterhalten und sich zu zwitschern, wie schön die Welt ist, die ich gerade mit meinem Blick erschaffe. Ich nehme den Wind wahr, der mir zuflüstert, welche Möglichkeiten es in dieser Welt gibt.
Ich schaue mich nach der Füchsin um. Sie ist nicht mehr da, aber ich weiß, sie ist Teil von dem Wald. Von meinem Wald.
Ein Wald, der gut so ist, wie er ist. Nichts hat hier eine Funktion, nichts ist mechanisch. Es ist einfach. Der Wind erzählt mir von Stürmen, die im Laufe meines Alterns am Horizont aufziehen, von Gewittern und von schweren Blitzen und Donnern. Aber auch von Sonnenschein und Nächten der Ruhe. Aber in mir spüre ich meinen inneren Kompass, der mir helfen wird, mich in meinem Wald zurecht zu finden.

